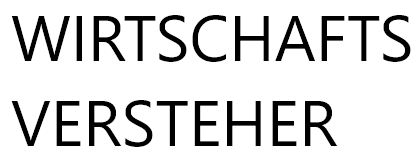Am 10. Juni findet in der Schweiz die Abstimmung über die Vollgeld-Initiative statt. Aber was steckt eigentlich hinter diesem Konzept? Was sind die Unterschiede zwischen dem aktuellen Geld-Regime und Vollgeld? Was wären Vor- und Nachteile und wie wäre der Übergang vom einen zum anderen System zu bewerkstelligen? Was wären mögliche Nebenwirkungen? Und gäbe es auch weniger drastische Massnahmen, welche zu einem ähnlichen Resultat führen?
Was unterscheidet Bargeld von elektronischem Geld?
Um die Ziele der Vollgeld-Initiative zu verstehen, ist es wichtig, die Unterschiede von Bargeld – also Noten und Münzen – und elektronischem Geld (auch als Buchgeld bezeichnet), beispielsweise unsere Kontosaldi bei den Banken, zu verstehen. Im täglichen Gebrauch fällt kein Unterschied auf – mit beidem kann man bezahlen und beides eignet sich zur Wertaufbewahrung. Aber nur Bargeld ist gesetzliches Zahlungsmittel und wird von der Nationalbank herausgegeben. Elektronisches Geld hingegen stellt lediglich ein Versprechen einer Geschäftsbank dar, dafür wieder Bargeld auszuhändigen. Auch das hat im Alltag kaum Unterschiede zur Folge, zwei gibt es allerdings:
- Aus Sicht des Bankkunden: Während Bargeld „konkurssicher“ ist, trifft dies auf Buchgeld nicht zu. Sollte die Bank, bei der man sein Konto hat, in Schwierigkeiten geraten, ist auch das Kontoguthaben gefährdet. Deshalb gibt es in vielen Ländern Einlagesicherungssysteme: Sie garantieren die Einlagen jedes Bankkunden bis zu einem gewissen Maximalbetrag – in der Schweiz 100’000 Franken. Kontoguthaben, welche diesen Betrag übersteigen, sind aber definitiv gefährdet.
- Aus Sicht der Bank: Mit Buchgeld kann sie das sogenannte Zinsdifferenzgeschäft betreiben. Das bedeutet, dass die Bank Geld verleiht, das sie gar nicht besitzt, sondern das ihr die Einleger zur Verfügung stellen. Auf diesen Ausleihungen verlangt sie dann höhere Zinsen als sie auf den Einlagen gewährt und erwirtschaftet somit einen Gewinn – falls sie das Geld auch wieder zurückbekommt. Ganz so einfach ist es also doch nicht mit dem Gewinn: Neben der Bedingung, dass der Kredit nicht ausfallen darf, muss die Bank den Kredit auch mit Eigenkapital hinterlegen. Im aktuellen System nicht mit 100%, sondern mit einem Prozentsatz, welcher im Wesentlichen vom Risiko des vergebenen Kredits abhängt. Ausserdem ist die Bank in diesem Prozess für die Fristentransformation (kurzfristige Einlagen, langfristige Ausleihungen) und die Losgrössentransformation (meist viele kleine Einlagen, wenige grosse Ausleihungen) zuständig.
Geldschöpfung im eigentlichen Sinn kann die Bank mit diesem Geschäft aber nicht betreiben, dies bleibt der Nationalbank vorbehalten, welche Geld „aus dem Nichts“ schöpfen kann.
Was bedeutet das konkret?
Zunächst sollte man sich vor Augen führen, wie viel Geld dieser beiden Sorten aktuell existiert. Hier helfen die Geldmengendefinitionen der Schweizerischen Nationalbank (SNB). Der Noten- und Münzumlauf beläuft sich demzufolge per Ende Februar 2018 auf total gut CHF 82 Milliarden. Die Notenbankgeldmenge, welche sich aus dem Notenumlauf und den Girokonten der Geschäftsbanken bei der Nationalbank zusammensetzt, beläuft sich auf ca. CHF 550 Milliarden. Demgegenüber beläuft sich die Geldmenge M3, welche als guter Anhaltspunkt für die Menge des elektronischen Geldes dient, auf etwas über 1’000 Milliarden. Die Menge des elektronischen Geldes ist also auf jeden Fall grösser, als jene Geldmengen, welche die Nationalbank direkt oder indirekt steuert. Dies bedeutet auch, dass die Geschäftsbanken im Geldschöpfungsprozess eine wichtige Rolle spielen, wenn auch nur indirekt und im Zusammenspiel mit der Nationalbank.
Die Wichtigkeit der Rolle der Geschäftsbanken im Prozess der Steuerung der Geldmenge wird vor allem dann augenfällig, wenn der Prozess nicht so funktioniert, wie von der Zentralbank vorgesehen. Im Nachgang der Bankenkrise von 2008 und der darauf folgenden Staatsschuldenkrise haben viele Zentralbanken grosse Anstrengungen unternommen, die Geldmenge auszuweiten. Die Geschäftsbanken wiederum, welche diese Geldmengenerweiterung hätten mittragen sollen, waren gleichzeitig von schärferen regulatorischen Vorschriften gezwungen, mehr Eigenkapital zu halten. Somit waren sie nicht in der Lage, Kredite zu gewähren und die lockere Geldpolitik der Zentralbanken kam nur verzögert und in verringertem Ausmass in der Realwirtschaft an.
Was haben Bargeld und elektronisches Geld gemeinsam?
Sowohl Bargeld als auch elektronisches Geld eignen sich unter normalen Umständen gleichermassen für die drei Hauptzwecke des Geldes: Neben den bereits weiter oben erwähnten Zwecke „Zahlungsmittel“ und „Wertaufbewahrung“ gehört hierzu auch die Funktion der Recheneinheit. Hierunter versteht man die Möglichkeit, über einen Preis den Wert völlig verschiedener Waren und Dienstleistungen vergleichbar zu machen (Beispiel: Wie viele Forellen ist ein Haarschnitt wert?).
Neben diesen gemeinsamen Vorteilen haben Bargeld und elektronisches Geld aber auch Nachteile gemeinsam: Beide unterliegen beispielsweise der Entwertung durch Inflation. Da die Inflationsraten in weiten Teilen der Welt aktuell eher niedrig sind (und bis vor kurzem teilweise noch negativ waren), wird dies aktuell kaum als Problem wahrgenommen – das kann sich aber wieder ändern. Der zweite wichtige Nachteil, den beide Geldformen mit sich bringen, ist, dass es sich bei beiden um sogenanntes „fiat money“, also „Vertrauens-Geld“ handelt. Auch wenn eine Notenbank kaum bankrott gehen kann, so kann sie doch keine absolute Sicherheit für das von ihr ausgegebene Geld bieten. Der Wert unseres Geldes beruht auf dem Vertrauen, morgen noch jemanden zu finde, der bereit ist, es im Austausch für Waren oder Dienstleistungen entgegenzunehmen. In Fall der Fälle wird eine Notenbank wohl eher nicht bankrott gehen, sondern einfach mehr Geld aus dem Nichts schöpfen und in Umlauf bringen – das bringt uns dann wieder zurück zum ersten gemeinsamen Nachteil von Bargeld und elektronischem Geld, der Entwertung durch Inflation.
Was will die Vollgeldinitiative erreichen?
Die Vollgeldinitiative will erreichen, dass die Geschäftsbanken nicht mehr Teil des Geldschöpfungsprozesses sind. Davon versprechen sich die Initianten eine bessere Geldpolitik und den Schutz der Sparer im Falle eines Bankenkonkurses. Hier handelt es sich also um absolut vernünftige Ziele. Die Initianten wollen die Umsetzung so gestalten, dass auch elektronisches Geld zukünftig von der Nationalbank geschöpft wird. Das bedeutet, dass die Nationalbank nicht nur Noten druckt und in Umlauf bringt, sondern auch elektronisches Geld könnte nur noch von der Nationalbank in Umlauf gebracht werden. Somit könnte die Nationalbank ihre Geldpolitik viel direkter steuern als dies bislang der Fall ist. Die Banken sollten zwar weiterhin Ausleihungen mittels Kundeneinlagen tätigen dürfen, aber dies wird nicht mehr mit normalen Transaktionskonten möglich sein, sondern nur noch mit speziellen Konten, welche der Bank explizit die Möglichkeit einräumen, dass Geld ihrerseits zu verleihen.
Was sind die potentiellen Vor- und Nachteile dieser Regelung?
Zunächst gilt es festzuhalten, dass sowohl das aktuelle Modell als auch das Vollgeldregime sowohl Vor- wie auch Nachteile haben. Teilweise lässt sich aber schwer abschätzen, welches Modell besser wäre. Gerade in der Geldmengensteuerung ist bei pauschalen Aussagen Vorsicht geboten.
Wenn man der Nationalbank volles Vertrauen schenkt, ist es natürlich wünschenswert, dass diese ihre Geldpolitik direkter umsetzen kann. Es ist aber fraglich, ob dies tatsächlich zu einem besseren Resultat führen würde. Einerseits haben sich die Notenbanken gut an das System der indirekten Beeinflussung der Geldmengen via Leitzinsen gewöhnt, andererseits verfügen die Geschäftsbanken über ihre Kundenbeziehungen über Wirtschaftsinformationen, welche der Nationalbank nicht vorliegen. Ausserdem führt eine Diversifikation der Risikobeurteilungen durch verschiedene Banken zu einer geordneteren Beschleunigung und Verlangsamung der Kreditvergabe, als wenn eine zentrale Instanz „digital“ entscheidet. Eine gewissen „Dezentralisierung“ der Geldpolitik kann also durchaus Sinn machen. Anderenfalls würde die Zentralbank direkt die Kreditvergabe steuern, was volkswirtschaftlich nicht wünschenswert ist.
Der andere Punkt betrifft den der Sicherheit der Spargelder. Hier scheint der Fall klar: Notenbankgeld ist sicherer als Geschäftsbankgeld, da eine Notenbank nicht bankrott gehen kann (sie kann auch mit negativem Eigenkapital weiter existieren, da sie Geld schöpfen kann). Allerdings hat auch diese Lösung Nachteile: Um weiterhin Kredite gewähren zu können, werden die Banken „Bankkonten für Nicht-Notenbankgeld“ anbieten, um daraus ihre Ausleihungen zu finanzieren. Diese würden den ganzen Vorteil für die Sparer zunichte machen, da sie wieder der Gefahr einer Bankeninsolvenz ausgesetzt wären. Natürlich kann man argumentieren, dass der Sparer ein solches Konto nicht nutzen muss – dann können Banken aber auch keine Kredite mehr gewähren. Ausserdem werden Banken den Service der Geldaufbewahrung und des Zahlungsverkehrs natürlich nicht gratis anbieten. Bisher haben sie die Möglichkeit, zumindest einen Teil der Kosten via Zinsdifferenzgeschäft zu kompensieren. In einem Vollgeld-Regime müssten diese vollumfänglich durch Kontoführungs- und Zahlungsverkehrs-Gebühren gedeckt werden. Es ist aber absehbar, dass der Weg der „Bankkonten für Nicht-Notenbankgeld“ eingeschlagen würde – getreu dem Motto Menschen reagieren auf Anreize.
Der grösste Nachteil eines Vollgeld-Regimes liegt aber in der Umstellung vom heutigen System zum neuen System. Da Banken heute langfristige Ausleihungen in ihren Büchern stehen haben (beispielsweise Hypothekardarlehen für 15 Jahre) müssten sehr lange Übergangsfristen gelten. Auch sonst wäre der Übergang vom heutigen System zu Vollgeld alles andere als einfach: Wie kommt jeder Kontoinhaber bei einer Schweizer Bank zu einem „Vollgeld-Konto“? Können Personen mit Wohnsitz im Ausland überhaupt ein solches eröffnen? Welche Friktionen entstehen in der Zeit zwischen Beschluss und Umsetzung?
Fazit und Alternative zum vollgeld
Es ist nicht klar, ob mit Vollgeld die Ziele der Initiative zu erreichen sind. Vermutlich wäre der neue Zustand nicht wesentlich besser oder schlechter als der heutige, sondern schlicht anders. Aus dieser Sicht sind die Risiken und Kosten einer Umstellung nicht zu rechtfertigen.
Die Ziele der Vollgeldinitiative sind aber auch mit weniger radikalen Schritten zumindest ein Stück weit erreichbar: Der Konkursschutz für Spareinlagen wäre beispielsweise dadurch erreichbar, dass alle Sparer (vermutlich eingeschränkt auf Einwohner und/oder Bürger Schweiz) die Möglichkeit (aber nicht die Pflicht) erhalten, ein eigenes Konto bei der SNB zu eröffnen. Diese wäre nicht verzinst und nicht zum regelmässigen Zahlungsverkehr geeignet. Dadurch entstünde eine Konkurrenz zwischen Geschäftsbanken und Nationalbank was Spargelder anbelangt, aber nicht wenn es um Transaktionskonten für regelmässige Zahlungen geht. Dies würde wohl zu leicht höheren Zinsen bei den Geschäftsbanken für Einlagen und Kredite führen. Hätte aber ansonsten kaum Auswirkungen. Die maximale Höhe der Spareinlagen pro Person bei der SNB wäre aus zwei Gründen zu beschränken: Einerseits soll so nicht zu viel Geld dem übrigen Wirtschaftskreislauf entzogen werden, andererseits sind vor allem die finanzielle Unter- und Mittelschicht schutzbedürftig bezüglich Bankkonkursen. Personen mit einem umfangreicheren Vermögen haben auch heute viele Möglichkeiten, sich dagegen weitgehend abzusichern.
Durch diese Sparkonten bei der SNB stünde dieser auch ein weiteres Mittel der Geldpolitik offen: Die Verzinsung dieser Konten. Hier hätte die Notenbank die Möglichkeit sowohl positive als auch negative Zinsen direkt an die Sparer weiterzugeben, statt dafür den Weg über die Geschäftsbanken gehen zu müssen. Dennoch wären die Geschäftsbanken weiterhin in der Lage, ihre eigenen Zinssätze für Einlagen und Kredite festzulegen und könnten somit die Auswirkungen einer Notenbankentscheidung dämpfen.